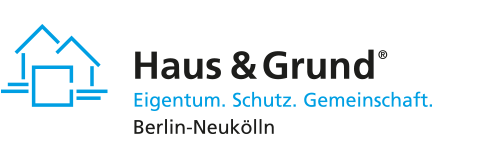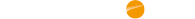Die Planung und die Konstruktion stehen allerdings in Abhängigkeit von der gewünschten Nutzung.
Der rechtliche Rahmen
Je nach Bundesland und Größe bedarf es für dieses Vorhaben eine Baugenehmigung. Es ist deshalb ratsam, sich bei den zuständigen Baubehörden zu erkundigen und einen Fachhandwerker zu Rate zu ziehen. Mit einer Bauvoranfrage lässt sich rechtssicher klären, ob und für welche Bauweise es Einschränkungen von den Behörden gibt oder ob gar eine Baugenehmigung erforderlich ist. Soll der Wintergarten ganzjährig als Wohnraum dienen, ist eine richtig dimensionierte Heizung unverzichtbar. Meist sind durch Grundstücksgrenzen, vorgegebene Abstandsflächen, Brandschutz, freizuhaltende Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Flucht und Rettungswege die Realisierungsmöglichkeiten beschnitten.
Ausrichtung und Architektur
Unterm Strich hat man als Bauherr damit in der Regel nicht unbegrenzte Möglichkeiten. Dennoch sollte man bei der Gestaltung ein paar Orientierungslinien im Blick haben – zum Beispiel wenn es um die Ausrichtung des Wintergartens geht. Wer vorwiegend den Wintergarten als Frühstücksraum wünscht, dem bietet sich natürlich ein Ostanbau an. Wenn hier der Feierabend genossen werden soll, dann wäre eine Westlage zu bevorzugen. Ein wichtiges Auswahlkriterium ist häufig die Aussicht aus dem Wintergarten.
Beim Bau selbst fängt auch beim Wintergarten alles mit einem guten Fundament an. Die Architektur sollte zu der des Hauses passen. Als Material werden Stahl, Aluminium, Holz oder Kunststoff verwendet. Teilweise werden die Materialien auch kombiniert. Die Größe des Wintergartens muss in einem angemessenen Verhältnis zum Gebäude stehen und hängt darüber hinaus von der geplanten Nutzung ab. Im Sommer sollte sich der Wintergarten nicht zu stark aufheizen. Neben speziellen Gläsern mit Sonnenschutz für Dach und Fenster können hier vor allem Markisen im Außen- und Innenbereich für genügend Schatten sorgen.
Anforderungen nach dem Gebäudeenergiegesetz
Besonders einfach hat es, wer einen Kaltwintergarten oder einen Wintergarten plant, der nicht dauerhaft beheizt wird. Denn in diesen Fällen werden keine besonderen Anforderungen an die Glasanbauten gestellt. Die Ausnahmeregelungen sind:
- Keine Beheizung oder Beheizung auf weniger als 12 Grad Celsius,
- Beheizung in einem Zeitraum von weniger als vier Monaten im Jahr,
- Beheizung für eine begrenzte Nutzungsdauer pro Jahr. In diesem Fall muss der Energieverbrauch weniger als ein Viertel der Summe betragen, die bei einer durchgehenden Beheizung zu erwarten wäre.
Doch auch wer einen Wohnwintergarten – also einen ganzjährigen beheizten Anbau – errichtet, wird von den strengen Neubaustandards weitgehend verschont. Hier kommt es auf die Fläche und den Anschluss an das Heizsystem an. So sind die Vorgaben aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) bei Wintergärten durch Bauteile, die einen ausreichenden Wärmeschutz und eine ausreichende Luftdichtheit aufweisen, unter folgenden Voraussetzungen erfüllt:
- wenn die Fläche des Wintergartens weniger als 50 Quadratmeter beträgt,
- die Beheizung über das bestehende Heizsystem erfolgt und kein neuer Heizkessel eingebaut werden muss.
Erst bei sehr großen Wintergärten, deren Grundfläche mehr als 50 Quadratmeter beträgt, oder bei Einbau eines neuen Wärmeerzeugers greifen die Neubaustandards. Das bedeutet, dass in diesen Fällen der Primärenergiebedarf für den Anbau berechnet und nachgewiesen werden muss. Außerdem muss der Wärmeerzeuger die Anforderungen des GEG erfüllen.