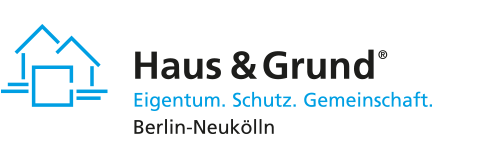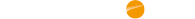Der europäische Markt für Wärmepumpen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, jedoch mit deutlichen regionalen Unterschieden. In Skandinavien werden Wärmepumpen mittlerweile als Standardlösung für die Gebäudebeheizung betrachtet, während in Deutschland im Jahr 2023 nur 27 Prozent der neu installierten Wärmeerzeuger auf dieser Technologie basierten. Der Absatz in Deutschland blieb damit mit 11 Wärmepumpen pro 1.000 Haushalte im Jahr 2023 weit hinter Ländern wie Norwegen, wo im gleichen Zeitraum 57 Wärmepumpen pro 1.000 Haushalte installiert wurden, oder Schweden mit 36 Geräten pro 1.000 Haushalte.
Besonders auffällig ist der Einfluss der jeweiligen nationalen Energiepolitik auf die Verbreitung. Während in Norwegen und Schweden die Energiepreise so gestaltet sind, dass der Betrieb von Wärmepumpen günstiger als konventionelle Heizsysteme ist, besteht in Deutschland ein anderes Verhältnis: Hier ist der Strompreis im Vergleich zu Gas noch immer relativ hoch, was die langfristige Wirtschaftlichkeit der Technologie schmälert.
Der Einfluss des Strom-Gas-Preisverhältnisses auf die Investitionsentscheidung
Die Studie der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) legt dar, dass die Preisrelation zwischen Strom und Gas eine wesentliche Rolle für die Entscheidung zugunsten einer Wärmepumpe spielt. Wenn – wie in Skandinavien – Strom günstiger als Gas ist, sind Wärmepumpen besonders attraktiv. In Deutschland hingegen wird der Strompreis durch Steuern, Umlagen und Abgaben in die Höhe getrieben, während Gas in der Vergangenheit relativ günstig war.
Diese Preisstruktur beeinflusst nicht nur den Absatz, sondern auch die regionalen Unterschiede innerhalb Deutschlands. In Gegenden mit hoher Verfügbarkeit erneuerbarer Energien und spezifischen Tarifangeboten für Wärmepumpen werden diese deutlich häufiger eingesetzt als in Regionen, in denen konventionelle Heizsysteme weiterhin wirtschaftlich attraktiver erscheinen.
Politische Stellschrauben zur Verbesserung der Marktdurchdringung
Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass wirtschaftliche Anreize und regulatorische Anpassungen entscheidend für den Hochlauf von Wärmepumpen in Deutschland sind. Neben der Förderung durch direkte Zuschüsse gibt es weitere Maßnahmen, die sich als effektiv erwiesen haben. Ein steigender CO₂-Preis auf fossile Brennstoffe kann die relative Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen verbessern und fossile Heizsysteme weniger attraktiv machen. Zeitvariable Strompreise, die sich an der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien orientieren, könnten den Betrieb von Wärmepumpen günstiger machen. Die Ausbildung von mehr Installateuren kann langfristig die Installationskosten senken und eine zügigere Marktdurchdringung ermöglichen. Statt Zuschüssen könnten vielmehr zinsgünstige Kredite für Investitionen in effiziente Heiztechnik dazu beitragen, finanzielle Hürden für Eigentümer zu senken.
Fazit
Die Wärmepumpe ist eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende im Gebäudesektor, aber ihre Verbreitung in Deutschland bleibt hinter dem europäischen Durchschnitt zurück. Neben den hohen Anschaffungskosten stellt insbesondere das ungünstige Verhältnis von Strom- zu Gaspreisen eine wirtschaftliche Hürde dar. Eine gezielte Anpassung der regulatorischen Rahmenbedingungen und wirtschaftlichen Anreize könnten dazu beitragen, die Verbreitung dieser klimafreundlichen Heiztechnologie in Deutschland nachhaltig zu steigern.