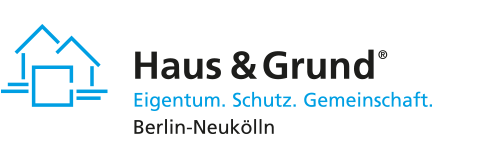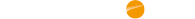Private Windkraftnutzung
Die Idee, private Windkraft zur Stromerzeugung zu nutzen, entspringt oft dem Wunsch nach Unabhängigkeit von den großen Energieversorgern. Auch finanzielle Aspekte spielen eine Rolle: Wer seinen Strom selbst produziert, kann langfristig Kosten sparen.
Optionen für private Windkraft
Private Windkraftanlagen haben ihre Wurzeln bereits im frühen 20. Jahrhundert. Die Entwicklung dieser Technologie verlief parallel zur Entstehung und Weiterentwicklung der großen Windkraftanlagen, die wir heute in Windparks sehen. Seit den 2000er-Jahren haben private Windkraftanlagen einen erheblichen Aufschwung erlebt. Technologische Verbesserungen, sinkende Produktionskosten und ein verstärktes Bewusstsein für die Notwendigkeit von nachhaltigen Energielösungen haben dazu geführt, dass immer mehr Menschen in private Windkraftanlagen investieren. Heute gibt es eine Vielzahl von Modellen, die für unterschiedliche Bedürfnisse und Standortbedingungen geeignet sind. Generell unterscheidet man zwischen Horizontalachsen- und Vertikalachsen-Windkraftanlagen.
Horizontalachsen-Windkraftanlagen (HAWT): Diese Anlagen ähneln den großen Windrädern, die man von Windparks kennt. Die Rotorblätter sind so konstruiert, dass sie bei Windströmung Auftrieb erzeugen, ähnlich wie die Tragflächen eines Flugzeugs. Dieser Auftrieb führt dazu, dass sich die Rotorblätter drehen. Diese Bewegung wird über die Nabe und die Hauptachse auf den Generator in der Gondel übertragen, der die kinetische Energie des Windes in elektrische Energie umwandelt. Horizontalachsen-Windkraftanlagen sind leistungsstark und effizient, benötigen jedoch ausreichend Platz und eine freie Fläche, damit der Wind ungehindert auf die Rotorblätter treffen kann. Für Grundstücke in dicht bebauten Gegenden sind sie darum weniger geeignet, zumal man hier die örtlichen Vorgaben einer Anlage in dieser Höhe beachten muss. Viele Bundesländer erlauben allerdings Windturbinen bis 10 Meter Höhe ohne Genehmigung.
Vertikalachsen-Windkraftanlagen (VAWT): Auch hier fangen die Rotorblätter den Wind ein und beginnen dann, sich um die vertikale Achse zu drehen. Die Drehbewegung der Achse wird auf den Generator übertragen, der die kinetische Energie in elektrische Energie umwandelt. VAWT-Modelle sind kompakter und eignen sich auch für den Einsatz in städtischen Gebieten oder auf Dächern. Sie sind unempfindlicher gegenüber Turbulenzen und benötigen weniger Platz, bieten jedoch oft weniger Effizienz als ihre horizontalen Pendants.
Kosten einer privaten Windkraftanlage
Die Anschaffungskosten für private Windkraftanlagen variieren stark je nach Typ und Leistung. Kleinere Vertikalachsen-Anlagen sind bereits ab etwa 3.000 bis 5.000 Euro zu haben. Größere Horizontalachsen-Modelle können hingegen schnell 10.000 Euro und mehr kosten. Zusätzlich zum reinen Anschaffungspreis müssen auch die Installationskosten berücksichtigt werden, die je nach Aufwand und Standort variieren können. Inklusive Montage und Inbetriebnahme sollte man bei kleineren Anlagen mit Gesamtkosten von 6.000 bis 10.000 Euro rechnen, bei größeren Anlagen können es auch 15.000 Euro oder mehr sein.
Anschaffung einer Windkraftanlage
Ob sich die Anschaffung einer privaten Windkraftanlage lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind vor allem der Standort, die lokale durchschnittliche Windgeschwindigkeit und der eigene Stromverbrauch. Hier ein Rechenbeispiel: Angenommen, eine Familie entscheidet sich für eine Horizontalachsen-Windkraftanlage mit einer Leistung von 5 Kilowatt, wie sie die meisten Anlagen bieten. Diese kann je nach Lage zwischen 2.500 und 10.000 Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr erzeugen. Die Kosten für Anschaffung und Installation betragen insgesamt 15.000 Euro. Vorausgesetzt, es gelingt, 4.000 kWh Strom pro Jahr zu generieren: Bei einem aktuellen Strompreis von 30 Cent pro kWh ergäbe sich dann eine jährliche Einsparung von 1.200 Euro (4.000 kWh x 0,30 Euro/kWh). Somit würde sich die Investition nach etwa 12,5 Jahren amortisieren (15.000 Euro / 1.200 Euro pro Jahr) – vorausgesetzt der Strom kann tatsächlich auch immer gleich verbraucht werden. Andernfalls könnte die Familie von staatlichen Förderungen in Form einer Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz profitieren, die die Amortisationszeit verkürzen würden. Darüber hinaus gibt es regionale Fördertöpfe.