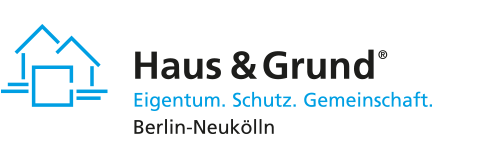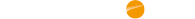Im Neubau ist die Fußbodenheizung schon oft Standard. Aber auch bei Modernisierungsprojekten ist sie vermehrt gefragt. Das liegt nicht zuletzt an den Änderungen, die durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG), auch Heizungsgesetz genannt, bedingt sind.
Die Fußbodenheizung zählt zu den sogenannten Flächenheizungen: Im Gegensatz zu an der Wand montierten Heizkörpern arbeitet sie mit der gesamten Bodenfläche. Durch die große Heizfläche kann die Vorlauftemperatur des Heizwassers geringer sein als bei konventionellen Heizkörpern, was sie für Energiequellen wie die Wärmepumpe prädestiniert, da diese dann besonders energiesparend arbeiten kann.
65 Prozent erneuerbare Energien beim Einbau von neuen Heizungen ab 2024
Mit der Änderung durch das GEG und der Umsetzung der sogenannten 65-Prozent-Erneuerbare Energien-Vorgabe wurde der Umstieg auf klimafreundliche Heizungen eingeleitet. Ziel ist es, dass künftig grundsätzlich nur noch Heizungsanlagen neu eingebaut werden, die mindestens 65 Prozent der bereitgestellten Wärme mit erneuerbaren Energien erzeugen. Diese Regelung greift, sobald die jeweilige Gemeinde eine kommunale Wärmeplanung vorgelegt hat. Städte ab 100.000 Einwohnern müssen diese bis zum 30. Juni 2026 vorgelegt haben; Städte unter 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2028. Falls eine Kommune die Wärmeplanung früher ausweist, greift die 65-Prozent-Regelung bereits ab diesem Zeitpunkt.
Wärmepumpe oft einzige Option
Um die 65-Prozent-Regelung künftig zu erfüllen, gibt es – zumindest grundsätzlich – verschiedene Optionen:
- Anschluss an ein Wärmenetz,
- Installation einer Wärmepumpe,
- Installation einer Stromdirektheizung (nur zulässig bei gut gedämmten Gebäuden, die die Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 40 (Neubau) beziehungsweise KfW-Effizienzhaus 55 (Altbau) erfüllen),
- Nutzung von Solarthermie,
- Nutzung von Biomasse oder grünem Wasserstoff,
- Installation einer Hybrid-Heizung.
Für den Bereich der Modernisierung werden Stromdirektheizungen aufgrund der damit verbundenen hohen Dämmanforderungen nur eine untergeordnete Rolle spielen können. Gleiches gilt für die Solarthermie wegen der damit einhergehenden Standort- und Pufferspeicherproblematik. Sie kann nur einen eher geringen Teil der geforderten 65 Prozent abdecken, da niemand in unseren Breitengraden über ein ganzjährig sonniges Dach verfügt. Biomasse ist nicht ausreichend verfügbar und deshalb keine Standardlösung. Auch die Umrüstung von Gasheizungen auf Wasserstoff wird wohl keine realistische Perspektive sein, da er zu wenig verfügbar sowie zu teuer ist und zunächst vor allem für die Industrie benötigt wird. Der Einbau einer Hybrid-Heizung kann nur eine Zwischenlösung darstellen – schließlich ist die 65-Prozent-Vorgabe nur der erste Schritt in der Umstellung auf erneuerbare Energien. Spätestens ab 2045 müssen alle Heizungen vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
Als mögliche Energiequellen bleiben somit Wärmepumpen sowie der Anschluss an ein Wärmenetz. Ist Letzteres nicht verfügbar, haben viele Eigentümer genau eine Option: die Wärmepumpe, die besonders effizient in Kombination mit einer Fußbodenheizung funktioniert.
Trockensysteme im Bestand meist die bessere Wahl
Der Einbau einer klassischen Fußbodenheizung ist mit relativ viel Aufwand verbunden. Bei Neubauten greift man in der Regel auf das Nasssystem mit einem speziellen Estrich zurück. Dieser sogenannte Heizestrich muss nach dem Einbau rund einen Monat trocknen und einem genau vorgeschriebenen Heizplan entsprechend mit bestimmten Vorlauftemperaturen „trockengeheizt“ werden. Im Neubau stellt dies kein großes Hindernis dar, weil der Fußboden erstmalig angelegt wird und die Installation der Heizung damit einfach und vergleichsweise günstig ist, zum anderen die Wärmeübertragung und Speicherung durch den Heizestrich vorteilhaft ist.
Bei Altbauten und Modernisierungen würde der Einbau eines Nasssystems großen Aufwand und Kosten verursachen, was sich – wenn überhaupt – nur bei einer Kernsanierung lohnt, bei der ohnehin der Fußbodenbelag ausgetauscht werden muss. Zudem hat das Nasssystem ein hohes Gewicht, das alte Holzdecken in Altbauten nicht immer tragen können. Deshalb sind Trockensysteme, bei denen die Heizungsrohre direkt unter dem Bodenbelag in sogenannten Trockenestrichplatten liegen, hier die bessere Wahl.
Aufbauhöhe und Heizlastberechnung beachten
Ein weiterer zentraler Punkt bei der Nachrüstung einer Fußbodenheizung ist beispielsweise die zur Verfügung stehende Aufbauhöhe. Während beim Nasssystem die Aufbauhöhe relativ groß ist (meist 60 bis 95 Millimeter), reicht bei einem Dünnbett-Trockensystem eine geringere Aufbauhöhe von 20 bis 50 Millimetern aus. Dabei werden schlanke Heizrohre mit Noppenplatten oder Klippschienen direkt auf den vorhandenen Estrich oder Oberboden verlegt und anschließend mit einer Ausgleichmasse überspachtelt. Diese Masse bildet den tragfähigen Untergrund für den Fußboden, auf dem Laminat, Fliesen oder Teppich verlegt werden können.
Damit es auch warm genug wird, ist vorab die benötigte Heizleistung zu ermitteln. Für alle Systeme gilt, dass bei größeren Flächen in jedem Fall eine Planung durch einen Fachmann erforderlich ist.
Nachteile im Blick haben
Bei allem Komfort, den eine Fußbodenheizung verspricht – etwa die Platzersparnis und die gleichmäßige Wärmeausstrahlung ohne zusätzliche Luftzirkulation –, so gibt es doch auch einige Nachteile: Während eine Fußbodenheizung beim Neubau kaum oder nur etwas teurer als eine Anlage mit Heizkörpern ist, kann die Nachrüstung im Altbau oder bei Modernisierungen kostspielig werden. Die Investition sollte daher gut durchdacht sein. Gleiches gilt für Reparaturen: Deutet sich ein Leck an oder sind die Heizschlangen im Fußboden verstopft oder korrodiert, ist die Sanierung gegenüber der Variante mit den Heizkörpern keine günstige Dienstleistung. Im schlimmsten Fall muss der Bodenbelag entfernt und der Estrich aufgestemmt werden, um eine Reparatur vornehmen zu können. Bedenken sollte man auch, dass Fußbodenheizungen in ihrer Reaktion träge sind. Es kann im Vergleich zu Heizkörpern etwas länger dauern, bis der Raum warm ist.
Heizungswegweiser
Muss ich eine funktionierende Heizung austauschen? Darf ich eine Heizung reparieren? Ab wann greift für mich die 65-Prozent-Pflicht? Und was gilt, wenn meine Heizung älter als 30 Jahre ist? Darüber gibt der Heizungswegweiser des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) einen ersten Überblick. Den Wegweiser finden Sie unter:
bmwsb.bund.de/SharedDocs