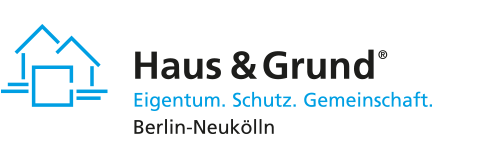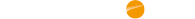Besonders komfortabel und sicher lädt man ein Elektroauto zu Hause – idealerweise über eine fest installierte Wallbox, in die Strom aus der hauseigenen Photovoltaik-Anlage gespeist wird. Dabei spielt die richtige Platzierung der Wallbox eine entscheidende Rolle: In der Regel wird die Ladestation an der Wand in der Garage oder im Carport montiert, alternativ kann sie auf einer stabilen Metallstele im Außenbereich stehen. Wichtig ist, dass der Abstand zwischen Wallbox und Ladeanschluss des Fahrzeugs nicht zu groß ist, um eine bequeme Handhabung des Ladekabels zu gewährleisten. Wird die Wallbox im Freien installiert, sollte sie zudem gut vor Wind und Wetter geschützt sein.
Auch wer aktuell noch kein E-Auto besitzt, sollte bei einem Neubau oder einer Sanierung bereits an zukünftige Lademöglichkeiten denken. Lehrrohre und passende Stromanschlüsse lassen sich frühzeitig einplanen – das erspart später kostspielige Nachrüstungen und ermöglicht eine flexible Anpassung an die Elektromobilität.
Wallbox wird über Fachbetrieb angemeldet
Steht der Einbau einer Wallbox an, sollte ein Elektro-Fachbetrieb hinzugezogen werden. Dieser prüft, ob die vorhandene Elektroinstallation für den gewünschten Standort geeignet ist, berät zu den notwendigen technischen Anforderungen und übernimmt die Anmeldung der Wallbox beim Netzbetreiber.
Bei der Wahl der Ladeleistung kommt es auf das individuelle Ladeverhalten an: Wer sein E-Auto hauptsächlich über Nacht zu Hause laden möchte, ist mit einer 11-Kilowatt-(kW)-Wallbox meist gut beraten. Wer hingegen auf eine schnellere Ladezeit angewiesen ist und dessen Fahrzeug dies unterstützt, der profitiert von einer leistungsstärkeren 22-kW-Wallbox.
Wie schnell ein Elektroauto tatsächlich geladen wird, hängt jedoch nicht nur von der Wallbox ab, sondern auch von der Ladetechnik des Fahrzeugs. Moderne E-Autos verfügen in der Regel über einen zwei- oder dreiphasigen On-Board-Charger, der das Laden effizienter macht. Zudem sind heute Typ-2-Stecker in Europa Standard – sie sorgen für eine einheitliche Kompatibilität zwischen Wallbox und Fahrzeug.
Wallbox muss steuerbar sein
Anders als früher müssen neu installierte Wallboxen heute steuerbar sein – so schreibt es der Gesetzgeber in § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vor. Der Grund: Um eine Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden, dürfen Verteilnetzbetreiber in bestimmten Situationen die Stromzufuhr vorübergehend drosseln.
Diese sogenannten steuerbaren oder smarten Wallboxen bieten jedoch nicht nur regulatorische Vorteile, sondern ermöglichen auch eine optimierte Nutzung des Ladestroms. So lassen sich Ladezeiten flexibel anpassen – beispielsweise kann das E-Auto gezielt dann geladen werden, wenn die eigene Photovoltaik-Anlage besonders viel Strom produziert oder wenn bei dynamischen Stromtarifen die Strompreise gerade niedrig sind. Voraussetzung dafür ist ein entsprechendes Energiemanagementsystem, das die Steuerung übernimmt und eine effiziente Nutzung der verfügbaren Energie gewährleistet.
Energiezähler in Erwägung ziehen
Wird die Wallbox nicht nur privat, sondern beispielsweise für ein Firmenfahrzeug oder von Nachbarn und Bekannten mitgenutzt, sollte sie über einen geeigneten Energiezähler verfügen. Ein mess- und eichrechtskonformer oder zumindest MID-zertifizierter Zähler ermöglicht eine präzise Abrechnung des verbrauchten Stroms und sorgt für Transparenz bei den Kosten.
Die Gesamtausgaben für die Installation einer Wallbox hängen sowohl von den Gerätekosten als auch vom Installationsaufwand vor Ort ab. Smarte Wallboxen sind bereits für wenige Hundert Euro erhältlich, doch die Einbaukosten variieren je nach den baulichen Gegebenheiten und der vorhandenen Elektroinstallation.
Um sich vor finanziellen Risiken zu schützen, lohnt es sich, den Versicherungsschutz der Wallbox zu überprüfen. Idealerweise kann sie als fester Bestandteil des Gebäudes in die Wohngebäudeversicherung aufgenommen werden. Je nach Vertragsbedingungen sind dann auch Schäden durch Sturm, Hagel oder Überspannung infolge eines Gewitters abgedeckt. Alternativ kann die Wallbox über die Hausratversicherung mitversichert werden. Wird sie von Mietern genutzt, empfiehlt sich eine private Haftpflichtversicherung mit Forderungsausfalldeckung, falls die Wallbox durch Dritte beschädigt wird. Schäden wie Marderbisse während des Ladevorgangs sind hingegen in der Regel über eine Vollkaskoversicherung des Fahrzeugs abgedeckt. Eine verpflichtende Versicherung für Wallboxen besteht jedoch nicht.